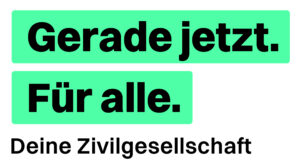Unser diesjähriger Fachtag fand unter dem Titel „Der Nahostkonflikt als Katalysator – Antisemitismus, Rassismus und Radikalisierung in Deutschland“ am 14. und 15. Mai statt. Lesen Sie hier den Rückblick.
Für das Publikationsformat Impuls sucht KN:IX ein*e Autor*in mit Expertise zum Thema „‚Islamischer Staat Provinz Khorasan‘: Hintergrund, Entwicklung und Bedeutung für Deutschland“ für das Verfassen eines Fachartikels (25.000 Zeichen, ca. 5-10 Seiten). Ziel ist die Vermittlung von fachlicher Expertise und Anregungen für die Präventionsarbeit. (mehr …)
Tausende gemeinnützige Organisationen leisten täglich wichtige Arbeit – zum Beispiel bei der Hilfe für Betroffene von Hass und Gewalt, der Bildungsarbeit für Kinder, der Förderung freiwilligen Engagements oder mit Initiativen für eine solidarische, offene Gesellschaft. Was wir tun, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Bundesregierung diskutiert aktuell Einsparungen, die die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisation existenziell bedrohen würden.
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind mit ihrem vielfältigen Engagement das Rückgrat der Demokratie!
Gemeinsam mit über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen setzen wir uns im Rahmen des Bündnisses #GeradeJetztFürAlle für die Stärkung der Zivilgesellschaft in Deutschland und gegen den geplanten Sparkurs ein. Unterstützen Sie jetzt die Petition und werden Sie Teil des Bündnisses!
Wie die Identitäre Bewegung und Generation Islam ihre Gegner*innen beschreiben und was wir daraus über sie erfahren
Der Artikel von Charlotte Leikert (BAG RelEx) erschien erstmals im Rahmen des KN:IX Report 2023.
Weichenstellungen für Demokratieförderung und Extremismusprävention
Der Artikel von Rüdiger José Hamm (BAG RelEx) erschien erstmals im Rahmen des KN:IX Report 2023.
In einem Netzwerk, in dem in Deutschland 14 Mio. aktive Nutzer*innen angemeldet sind, wollen wir als BAG RelEx zukünftig auch hier die Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, innerhalb des Themenfeldes religiös begründeter Extremismus fördern und aktiv mitgestalten.
Wie haben islamistische Gruppen wie IS und Al-Qaida auf den Anschlag der Hamas am 07. Oktober 2023 reagiert? Welche Rolle spielt der israelisch-palästinensische Konflikt in ihrer Ideologie und wie instrumentalisieren sie das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung? Diesen Fragen widmen wir uns in Folge #22 von KN:IX talks. (mehr …)
Am 10. November 2023 haben die anwesenden Vertreter*innen unserer Mitgliedsorganisationen einen neuen Vorstand gewählt. Hier stellen wir die Mitglieder des Vorstands vor.
Im Rahmen unseres digitalen Fachgespräches am 29. November 2023 haben wir uns mit dem Thema Community-Building und Reichweite auf Social Media befasst und uns angeschaut, welchen Nutzen Radikalisierungsprävention daraus ziehen kann.
Für das Publikationsformat Impuls sucht KN:IX ein*e Autor*in mit Expertise zum Thema „Christfluencer*innen im Graubereich fundamentalistischen Christentums“ für das Verfassen eines Fachartikels (25.000 Zeichen, ca. 5-10 Seiten). Die Bewerbungsfrist ist der 18. Februar 2024.