Die Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus e. V. (BAG RelEx) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Projektassistent*in (m/w/d 75 %). Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2026 befristet; eine Verlängerung wird angestrebt. Lesen Sie hier die vollständige Stellenausschreibung.
(mehr …)
Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld islamistischer Radikalisierung
Kinder und Jugendliche befinden sich im Themenfeld der Prävention von islamistischem Extremismus in einem doppelten Spannungsfeld: Einerseits werden sie als potenzielle Sicherheitsrisiken wahrgenommen, andererseits zählen sie zu den verletzlichsten Gruppen, die von Radikalisierungsprozessen betroffen sind. Sicherheitsbehördliche Berichte zeigen eine zunehmende Beteiligung Minderjähriger an dschihadistisch motivierten Aktivitäten, wobei soziale Medien als zentrale Beschleuniger wirken. Digitale Räume verknüpfen jugendkulturelle Codes, Zugehörigkeitsbedürfnisse und extremistische Narrative, wodurch Radikalisierungsverläufe schneller und diffuser werden. Pädagogische Fachkräfte agieren hingegen in einer entwicklungsorientierten Logik und müssen zwischen Provokation, Symbolik und ideologischer Festigung unterscheiden. Eine wirkungsorientierte Praxislogik, die Jugendliche produktiv adressiert, entsteht nur durch koordiniertes Handeln und professionssensible Zusammenarbeit.
Laden Sie hier das policy:brief No. 6 (PDF) herunter.
Handlungsempfehlungen
-
- Eine zentrale Stellschraube liegt in der Regulierung sozialer Medien. Die Bundesregierung sollte ihr Engagement für die wirksame Regulierung digitaler Plattformen intensivieren und sich auf EU-Ebene aktiver und konsequenter an der Weiterentwicklung bestehender Regelwerke beteiligen. Die konsequente Umsetzung vorhandener rechtlicher Instrumente muss sichergestellt werden, und hier insbesondere eine verbindliche Moderation extremistischer Inhalte. Die Erfahrungen und Perspektiven der Jugendlichen als besonders aktive Nutzer*innen digitaler Räume sollten über Beteiligungsformate oder Jugendgremien systematisch einfließen, um eine realitätsnahe und zukunftsfähige Digitalpolitik zu gestalten.
- Neben dem gesetzlichen Bildungsauftrag der Schulen, Medienkompetenz systematisch zu fördern, müssen außerschulische Kontexte gestärkt werden. Gerade außerhalb der Schule entstehen geschützte Reflexionsräume, in denen Jugendliche digitale Inhalte kritisch hinterfragen, manipulative Strategien erkennen und Unsicherheiten offen thematisieren können. Außerschulische Bildungsträger sollten verstärkt durch Projekttage, Workshops oder längerfristige medienpädagogische Angebote eingebunden werden. Gleichzeitig braucht es attraktive, pädagogisch betreute Begegnungsorte offline wie online – von klassischen Jugendhäusern bis hin zu moderierten Discord-Servern oder Formen von Online-Streetwork. Solche Angebote sollten zentrale Brückennarrative adressieren, über die Jugendliche an extremistische Ideologien andocken: Antifeminismus, Anti-Gender-Ideologien, hypermaskuline Rollenvorstellungen sowie Gewaltfaszination.
- Zur Stärkung der Handlungssicherheit aller Beteiligten ist ein intensiver Austausch zwischen Sicherheitsbehörden, Verwaltung sowie pädagogischen und sozialarbeiterischen Akteur*innen notwendig. Die jeweiligen Zuständigkeiten und professionellen Kompetenzen müssen klar benannt und wechselseitig anerkannt werden. Institutionalisierte Austauschformate können Rollenprofile, Informationswege und Einschätzungslogiken transparent machen und aufeinander abstimmen. Dadurch lassen sich professionssensible Fallbearbeitungen, kohärente Interventionsschritte und eine konsequent präventive Praxis sicherstellen.
Laden Sie hier das policy:brief No. 6 (PDF) herunter.
Inhaltliche Rückfragen: Maida Ganević & Frederik Braune
Die Autor*innen
Maida Ganević ist seit April 2025 als Referentin für interreligiöse Zusammenarbeit bei der BAG RelEx tätig. Sie studierte Politikwissenschaft und Islamwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (BA) und setzte ihr weiterführendes Studium (MA) in Politikwissenschaft und Soziologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg fort, das sie auch zu einem Studienaufenthalt nach Istanbul führte. Bereits während ihres Studiums sammelte sie praktische Erfahrungen in den Themenfeldern der BAG RelEx, u. a. in einer Fach- und Beratungsstelle für universelle Extremismusprävention mit Fokus auf besonders schutzbedürftige Jugendliche. Seit 2024 ist sie Stipendiatin der Deutschlandstiftung Integration (Programm Diversify). Darüber hinaus engagiert sie sich als Multiplikatorin in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung und gibt Workshops u. a. zu Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus.
Frederik Braune ist Sozialarbeiter und seit Juli 2023 bei der BAG RelEx tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen „Radikalisierung auf Social Media“ und „Prävention im digitalen Raum“. Zuvor studierte er Internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften sowie Soziale Arbeit an der Fachhochschule Potsdam. Vor seiner Zeit bei der BAG RelEx war er einige Jahre bei einem Träger der Berliner Suchthilfe im Bereich der Wohnungslosenhilfe tätig.
Jamuna Oehlmann ist Geschäftsführerin der BAG RelEx und leitet seit 2025 KN:IX connect | Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Zuvor hatte Sie die Leitung des Kompetenznetzwerks „Islamistischer Extremismus“ (KN:IX, 2020-2024) inne. Sie verfügt über einen akademischen Hintergrund in Asienwissenschaften sowie Internationale Beziehungen und Diplomatie, den sie in Berlin, Bangkok und London erworben hat. In ihren Studien hat sie sich insbesondere mit Fragen der internationalen Sicherheit und des Terrorismus auseinandergesetzt.
Über policy:brief
Das policy:brief der BAG RelEx fasst Positionen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit prägnant zusammen und nimmt dabei besonders Bezug auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen und Herausforderungen. Das policy:brief geht auf der einen Seite einen Schritt zurück und erklärt Zusammenhänge und auf der anderen Seite einen Schritt weiter, indem es zielgruppenorientierte und -gerechte Handlungsempfehlungen enthält. Unsere Arbeit und die unserer rund 40 Mitgliedsorganisationen wird so zielgruppengerecht kommuniziert und der Austausch mit externen Stakeholdern und Akteuren aus Wissenschaft, Politk, Verwaltung und Wirtschaft unterfüttert. Hier kommen Sie zur Übersicht der Ausgaben.

Unser diesjähriges Forum:RelEx fand unter dem Titel „Rechtsruck und islamistische Radikalisierung, Wechselwirkungen, Herausforderungen und Prävention“ am 12. und 13. November statt. Lesen Sie hier den Rückblick.
Das Jahr 2025 war für uns von intensiver Arbeit und wichtigen Entwicklungen geprägt. Bevor wir in die letzten Arbeitstage des Jahres starten, möchten wir gemeinsam mit Ihnen auf die zentralen Ereignisse und Fortschritte unserer Projekte und Tätigkeiten zurückblicken.
Die vergangene Zeit haben uns erneut vor Augen geführt, wie fragil gesellschaftlicher Zusammenhalt sein kann. Der antisemitische Anschlag in Sydney sowie die jüngst bekannt gewordenen, vereitelten islamistischen Anschlagspläne in Deutschland machen deutlich, dass Gewalt und Hass weiterhin eine reale Bedrohung darstellen – für jüdisches Leben, für die Sicherheit vieler Menschen und für das friedliche Zusammenleben insgesamt.
Zugleich erinnern diese Ereignisse daran, wie wichtig eine differenzierte Auseinandersetzung mit Radikalisierungsprozessen und Prävention ist: eine Arbeit, die Gewalt entschieden benennt und verurteilt, ohne zu pauschalisieren, und die den Blick auf frühe Anzeichen, gesellschaftliche Spannungen und die Stärkung demokratischer Werte richtet. Auch 2026 werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass Extremismus und Abwertung keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.
Wir wünschen Ihnen erholsame freie Tage und einen entspannten Jahreswechsel sowie allen, die feiern, frohe Festtage.
Unser Jahr 2025
Die politische Interessenvertretung war auch 2025 ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Durch Gespräche mit Abgeordneten konnten wir zentrale Erfahrungen und Herausforderungen aus der Präventionspraxis einbringen. Unser Anliegen ist es, die Perspektiven der Zivilgesellschaft in politische Prozesse einzuspeisen und damit zur nachhaltigen Stärkung präventiver Ansätze beizutragen. Dazu leisteten wir unter anderem mit einem Input im Berliner Verfassungsschutzausschuss einen wichtigen Beitrag. So arbeiten wir kontinuierlich daran, dass Prävention gegen religiös begründeten Extremismus strukturell verankert und wirksam ausgestaltet wird. Neben den vielen Einzelgesprächen mit Politiker*innen ist auch das parlamentarische Frühstück, das wir im Rahmen von KN:IX connect mit Vertreter*innen des Berliner Abgeordnetenhauses durchgeführt haben, ein weiteres Beispiel für den gelungenen Austausch zwischen Zivilgesellschaft und Politik.
Durch Jamuna Oehlmann war die BAG RelEx bis zu ihrer Auflösung Mitte November in der Task Force Islamismusprävention des Bundesinnenministeriums (BMI) vertreten. Über das Jahr hinweg hat die Gruppe Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wir bedanken uns bei den Mitgliedern der Task Force, beim BMI sowie bei der Koordinierungsstelle für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffen, dass die Expertise aus der praktischen Radikalisierungsprävention auch zukünftig berücksichtigt wird.
Darüber hinaus ist Jamuna Oehlmann Teil der Berliner Enquête-Kommission „Für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung“.
Unter der Überschrift „Rechtsruck und islamistische Radikalisierung – Wechselwirkungen, Herausforderungen und Prävention“ fand unser diesjähriges Forum:RelEx Mitte November in Berlin statt. In ihren Keynotes gaben Dr. Cemal Öztürk und Dr. Sabrina Schmidt wichtige Impulse zu Co-Radikalisierung sowie zur Rolle der Medienberichterstattung und deren gesellschaftliche Auswirkungen. In mehreren Workshops vertieften die Teilnehmenden zentrale Themen wie Trauma und Extremismus, transnationale Prävention oder Rassismussensibilität. Wir danken allen Beteiligten für den intensiven Austausch und freuen uns bereits auf das Forum:RelEx 2026.
Auch in diesem Jahr waren wir als BAG RelEx auf zahlreichen Fachveranstaltungen unterwegs unsere Expertise in unterschiedlichsten Formaten ein. Mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen unter anderem auf der re:publica, dem Berliner Präventionstag, dem Deutschen Präventionstag und vielen mehr konnten wir aktuelle Entwicklungen zu Islamismusprävention, Radikalisierungsprozessen und digitalen Entwicklungen einordnen und Impulse geben. Auch der Austausch auf europäischer Ebene ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Das „Thematic Panel 4 – Local Dimension, Polarisation and Resilience“ des EU Knowledge Hubs bietet dafür eine gute Gelegenheit. Wir freuen uns, diese unterschiedlichen Aktivitäten 2026 fortzuführen und weiterhin wichtige Beiträge zur Fachdiskussion zu leisten.
Ein besonderes Highlight des Herbsts war für uns unsere Fach- und Netzwerkveranstaltungen mit Kolleg*innen unserer Mitgliedsorganisationen. Gemeinsam haben wir über die aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Radikalisierungsprävention gesprochen und wie wir diesen im Rahmen der BAG RelEx weiterhin begegnen wollen.
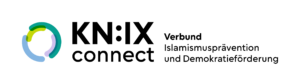
Seit Januar 2025 sind wir zusammen mit IFAK e. V., modus|zad und ufuq.de Teil von KN:IX connect | Verbund Islamismusmusprävention und Demokratieförderung. KN:IX connect ist ein Verbund im Programmbereich Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (BMBFSFJ). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Verbunds.
KN:IX talks
Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Podcast KN:IX talks im Rahmen von KN:IX connect fortsetzen. In den Folgen sprechen wir mit Expert*innen aus Praxis und Wissenschaft über verschiedenste Fragen rund um das Themenfeld Islamismusprävention. Dieses Jahr wurden sieben Folgen umgesetzt:
- Folge #32 | Verschärfter Migrationskurs – Auswirkungen auf die Demokratie. Wie migrationsfeindliche uns rassistische Narrative das Vertrauen muslimischer Communities in Politik und Institutionen verringern
- Folge #33 | Syrien nach dem Machtwechsel und die Folgen für die syrische Diaspora. Wie eine islamistische Rebellengruppe Regierungsverantwortung übernimmt und was das für die Menschen hier und in Syrien bedeutet
- Folge #34 | Turbo-Onlineradikalisierung & und digitales Engagement. Digitale Räume als Radikalisierungsbeschleuniger – Gründe und Gegenstrategien.
- Folge #35 | Zivilgesellschaft unter Druck. Welchen Herausforderungen muss sich die Präventionsarbeit aktuell stellen und was braucht sie?
- Folge #36 | (K)ein Raum für Gefühle? Zum pädagogischen Umgang mit Emotionen nach dem 7. Oktober 2023
- Folge #37 | Verletzlich und gefährlich?! Der Zusammen von Psychischer Gesundheit, Gewalt und Extremismus bei Kindern und Jugendlichen
- Folge #38 | Islamismus zwischen Schlagzeilen und Stigma. Wie deutsche Medien über islamistischen Terrorismus berichten.
Alle Folgen von KN:IX talks finden Sie hier und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die diesjährige Ausgabe der Ligante widmet sich dem komplexen Wechselspiel zwischen Rechtsruck und islamistischer Radikalisierung und zeigt anhand wissenschaftlicher Analysen, Perspektiven auf mediale Berichterstattung und aus zivilgesellschaftlicher Praxis auf, wie beide Dynamiken sich gegenseitig verstärken. Die Ligante #8 beleuchtet zentrale Entwicklungen sowie ihre Auswirkungen auf die Präventionsarbeit und gibt in einem Praxisinterview Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Ansatzpunkte für eine gesamtgesellschaftlich gedachte Prävention. Hier können Sie die Ligante #8 herunterladen.
Mit der Auftaktveranstaltung im Deutschen Bergbau-Museum Bochum hat KN:IX connect seinen offiziellen Start gefeiert und Fachkräfte aus Praxis, Wissenschaft und Politik zusammengebracht. Unter dem Titel „Unruhige Zeiten – starke Prävention!“ diskutierten die Teilnehmenden über aktuelle Herausforderungen der Islamismusprävention und erhielten vielfältige Impulse für eine vernetzte und zukunftsorientierte Präventionsarbeit. Die Veranstaltung markierte einen wichtigen Schritt, KN:IX connect als zentralen Partner für Austausch, Wissenstransfer und Professionalisierung sichtbar zu machen. Besonders bedanken möchten wir uns bei den Kolleg*innen von IFAK e. V., die die Veranstaltung federführend organisiert haben.
Im Rahmen eines Fachgesprächs haben wir uns Anfang Dezember damit beschäftigt, welche Schnittmengen es zwischen Kampfsport und Radikalisierungsprozessen gibt, wie Männlichkeitsbilder instrumentalisiert werden und welche Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit notwendig sind, um dem präventiv zu begegnen. Bei der Veranstaltung haben wir uns über hegemoniale Männlichkeitsbilder, hybride Narrative und spezifische Ästhetiken ausgetauscht, die die Schnittstellen zwischen Kampfsport und extremistischen Milieus prägen.

Seit dem Frühjahr sind wir Teil des EU-Projekts SHIELDed, bei wir mit 17 Partnerorganisationen aus neun EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Gefördert wird das Projekt über den Internal Security Fund. Im Mai sind wir zur Auftaktveranstaltung mit allen Akteuren in Lissabon zusammengekommen.
Bei SHIELDed steht die Stärkung lokaler Resilienz im Fokus. Es geht um den Aufbau und Begleitung von Netzwerken vor Ort zur Prävention von Hasskriminalität. Dazu sollen u. a. Schulungen oder Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Zentral für das Projekt ist vor allem die interdisziplinäre Vernetzung, in der marginalisierte Communities, Sicherheitsakteure, Fachpraxis, Bildungsträger und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.
Im Projekt verantworten wir die Konzeption und Durchführung der Shielding Councils. Das sind Austauschforen, in denen Vertreter*innen religiöser Einrichtungen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Behörden gemeinsam Schutzstrategien entwickeln. Zudem koordiniert wir die Verbreitung zentraler Projektergebnisse auf nationaler wie europäischer Ebene und entwickelt praxisnahe Handlungsempfehlungen, die zur nachhaltigen Stärkung der Resilienz beitragen.
Das erste Shielding Council in Deutschland fand Anfang Dezember in Hamburg statt. Gemeinsam mit der SCHURA Hamburg, die als zentraler lokaler Partner fungiert, kamen dabei Vertreter*innen verschiedener Communities, der Polizei, der Schul- und Sozialbehörde sowie Beratungsstellen zusammen. Bei der Veranstaltung wurden zentrale Bedarfe, Perspektiven und Herausforderungen der beteiligten Akteur*innen sichtbar – und erste Ansatzpunkte dafür, wie SHIELDed diese Bedarfe sinnvoll aufgreifen und unterstützen kann. Ein gelungener Auftakt, der neugierig auf alles macht, was noch kommt!
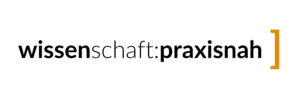
Mit wissenschaft:praxisnah haben wir 2025 eine neue Austauschplattform etabliert, die Wissenschaft, Praxis sowie Politik und Verwaltung zu einem kontinuierlichen Dialog zur Prävention von islamistischem Extremismus zusammenbringt. Das bpb-Modellprojekt fördert nachhaltige Netzwerke, erleichtert Wissenstransfer und unterstützt politische Entscheidungsprozesse durch fundierte Analysen und praxisnahe Impulse. Durch vielfältige Formate und Policy Briefs wird hier eine Grundlage geschaffen, um Präventionsansätze gemeinsam weiterzuentwickeln.
Ein Kernstück der Arbeit sind die Austauschplattformen, wie wir sie z. B. im Juni und September ausgerichtet haben. Bei diesen Veranstaltungen diskutierten wir zentrale Themen unseres Arbeitsfelds und bringen die Perspektiven der unterschiedlichen Bereiche zusammen. Dies konnten wir auch im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung im Oktober umsetzen.
Bei unserem ersten parlamentarischen Frühstück im Rahmen von wissenschaft:praxisnah kam es zu einem fruchtbaren Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik, mit fraktionsübergreifender Beteiligung. Diskutiert wurden die gesellschaftlichen Spannungsfelder im Kontext von Flucht, Migration und Islamismusprävention auf Basis des dritten Policy Briefs „Integration, Prävention, gesellschaftliche Stabilität“.
Die Transferveranstaltung im November zeigte eindrucksvoll, welchen Mehrwert ein interdisziplinärer Austausch für die Weiterentwicklung der Prävention von islamistischem Extremismus bietet. Vertreter*innen aus Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik diskutierten zentrale Herausforderungen des Wissenstransfers und machten deutlich, dass nachhaltige Prävention kontinuierliche Kooperation und offene Dialogräume erfordert. Die gewonnenen Impulse nehmen wir mit in die nächste Phase von wissenschaft:praxisnah und in unsere weitere Arbeit im kommenden Jahr.
Das Format policy:brief haben wir auch 2025 erfolgreich fortgesetzt. Hier eine Übersicht über die in diesem Jahr erschienenen Ausgaben:
- Policy:brief Sonderausgabe „Onlineprävention. Rahmenbedingungen und Standards für digitale Islamismusprävention“
- Policy:brief Sonderausgabe „Koalitionsimpuls. Inputpapier für die neue Bundesregierung“
- policy:brief No. 3 „Integration, Prävention, gesellschaftliche Stabilität. Gesellschaftliche Spannungsfelder im Kontext von Flucht, Migration und Islamismusprävention“
- policy:brief No. 4 „Zwischen Information und Alarmismus. Medien, Öffentlichkeit und Berichterstattung über islamistische Anschläge“
- policy:brief No. 5 „Vereinsverbote und was dann? Die Rolle von Vereinsverboten in der Bekämpfung von Islamismus“
Alle Ausgaben der policy:briefs finden Sie auf unserer Website.

Seit Herbst 2022 sind wir Teil des Verbundvorhabens PrEval – Zukunftswerkstätten, das sich mit Evaluation und Qualitätssicherung in der Extremismusprävention, Demokratieförderung und politischen Bildung beschäftigt.
Als Kooperationsveranstaltung von PrEval und KN:IX connect haben wir im November ein digitales Fachgespräch „Methodischer Austausch und Einblicke in die praktische Anwendung von Fragebögen als (Selbst-)Evaluationsinstrument“ durchgeführt. Wir bedanken uns bei der Referentin Farina Wäcker und den Teilnehmenden für diese angeregte Veranstaltung.
Ende November fand die Abschlusstagung von PrEval in Berlin statt. Wir freuen uns, dass wir unseren Beitrag im Rahmen des World Cafés der PrEval-Zukunftswerkstatt „Unterstützungsangebote“ leisten konnten. Zusammen mit den Teilnehmenden diskutierten wir, wie praxisnah Unterstützung gestaltet sein muss, um Evaluation verbessern zu können.
Bei der Tagung wurde auch der neue PrEval Monitor präsentiert. Die Publikation greift die zentralen Ergebnisse aus drei Jahren Projektarbeit auf und formuliert Empfehlungen an Politik und Praxis, um Extremismusprävention, Demokratieförderung und politische Bildung nachhaltig zu stärken – in Deutschland, aber auch international.
Mit Ende des Jahres geht auch das Projekt zu Ende. Wir möchten uns bei allen beteiligten Projektpartnern für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Das Thema Evaluation ist und bleib ein wichtiges Thema, das wir auch weiterhin in unserer Arbeit aufgreifen.
Die Rolle von Vereinsverboten in der Bekämpfung von Islamismus
Mit dem jüngsten Vereinsverbot gegen„Muslim Interaktiv“ im November 2025 hat das Bundesinnenministerium ein deutliches Signal im Umgang mit islamistischen Strukturen gesetzt. Zugleich zeigt der Blick auf die vorangegangenen Entwicklungen im Umfeld von „Muslim Interaktiv“,„Generation Islam“ und „Realität Islam“, dass sich islamistische Akteur*innen längst auf staatliche Eingriffe eingestellt haben. Trotz formaler Auflösungen blieben Inhalte, Narrative und Akteursnetzwerke bestehen; teils erreichen sie sogar neue Zielgruppen durch modernisierte Auftritte, jugendaffine Ästhetiken und professionalisierte Mobilisierung. Diese Dynamiken machen deutlich, dass Vereinsverbote zwar notwendige Eingriffe darstellen, ihre Wirksamkeit aber begrenzt bleibt, wenn sie ausschließlich repressiv gedacht werden. Erst in der engen Verzahnung mit präventiven Perspektiven lassen sich ideologische Kontinuitäten, Anschlussfähigkeiten und Nachfolgeformate nachhaltig adressieren.
Laden Sie hier das policy:brief No. 5 (PDF) herunter.
Handlungsempfehlungen
- Prävention mit repressiven Maßnahmen in Bezug auf Vereinsverbote verzahnen
Da Vereinsverbote zwar formale Strukturen zerschlagen, ideologische Kontinuitäten und digitale Anschlussfähigkeit jedoch häufig bestehen bleiben, müssen sicherheitspolitische Eingriffe konsequent durch stabile Präventionsstrukturen ergänzt werden. Präventionsarbeit adressiert jene Faktoren, die Radikalisierungsprozesse begünstigen, stärkt Resilienz und Teilhabe und schafft Zugänge zu Zielgruppen, die staatlichen Institutionen mit Misstrauen begegnen. Bund und Länder sollten Prävention daher als festen Bestandteil ihrer Strategien zur Bekämpfung extremistischer Ideologien institutionell absichern und langfristig finanzieren. - Intersektorale Kooperation ausbauen, um der Verlagerung von extremistischen Aktivitäten nach Verboten frühzeitig entgegenwirken zu können
Die Verlagerung extremistischer Aktivitäten in digitale, informelle oder transnationale Strukturen nach Vereinsverboten zeigt, dass isolierte Perspektiven nicht ausreichen, um die Dynamiken vollständig zu erfassen. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Forschung und zivilgesellschaftlichen Trägern ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von Nachfolgeformaten, neuen Mobilisierungsformen und digitalen Trendbewegungen. Intersektorale Kooperationsstrukturen sollten daher auf allen Ebenen systematisch gestärkt und dauerhaft verankert werden. - Sensibler Umgang mit Diskursen über Vereinsverbote Eine klare Kommunikation über die rechtliche Grundlage und Zielrichtung von Vereinsverboten kann zur Transparenz und Vertrauensbildung beitragen und einer ideologischen Instrumentalisierung durch extremistische Akteure entgegenwirken. Es sollte daher darauf geachtet werden, dass diese Debatten differenziert, rechtlich fundiert und im Einklang mit demokratischen Grundwerten geführt werden, da sie das Risiko bergen, Ausgrenzungserfahrungen junger Muslim*innen ungewollt zu verstärken – insbesondere dann, wenn sie einseitig oder stigmatisierend geführt werden.
Laden Sie hier das policy:brief No. 5 (PDF) herunter.
Inhaltliche Rückfragen: Ivo Lisitzki
Die Autor*innen
Ivo Lisitzki ist seit 2025 Referent für Politik und Europäische Vernetzung bei der BAG RelEx. Zuvor war er hier bis Dezember 2024 als Fachreferent für religiös motivierten Extremismus tätig. Er hat Politikmanagement (BA) und International Relations Middle East (MA) in Bremen, Istanbul und Durham studiert und im Anschluss vor allem zu religiös begründetem Extremismus in Zusammenhang mit Strafvollzug, Bewährungshilfe und Wiedereingliederung in die Gesellschaft bei der Senatorin für Justiz und Verfassung in Bremen gearbeitet und publiziert. Darüber hinaus hat Ivo Lisitzki in verschiedenen europäischen Projekten im Themenfeld Radikalisierung, Risk Assessment und Evaluation mitgewirkt.
Jamuna Oehlmann ist Geschäftsführerin der BAG RelEx und leitet seit 2025 KN:IX connect | Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Zuvor hatte Sie die Leitung des Kompetenznetzwerks „Islamistischer Extremismus“ (KN:IX, 2020-2024) inne. Sie verfügt über einen akademischen Hintergrund in Asienwissenschaften sowie Internationale Beziehungen und Diplomatie, den sie in Berlin, Bangkok und London erworben hat. In ihren Studien hat sie sich insbesondere mit Fragen der internationalen Sicherheit und des Terrorismus auseinandergesetzt.
Über policy:brief
Das policy:brief der BAG RelEx fasst Positionen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit prägnant zusammen und nimmt dabei besonders Bezug auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen und Herausforderungen. Das policy:brief geht auf der einen Seite einen Schritt zurück und erklärt Zusammenhänge und auf der anderen Seite einen Schritt weiter, indem es zielgruppenorientierte und -gerechte Handlungsempfehlungen enthält. Unsere Arbeit und die unserer rund 40 Mitgliedsorganisationen wird so zielgruppengerecht kommuniziert und der Austausch mit externen Stakeholdern und Akteuren aus Wissenschaft, Politk, Verwaltung und Wirtschaft unterfüttert. Hier kommen Sie zur Übersicht der Ausgaben.

Wie berichten deutsche Medien über islamistische Vorfälle – welche wiederkehrenden Narrative tauchen auf, wie wirken sie und was macht das mit unserer Gesellschaft? Darüber sprechen wir mit Dr. Sabrina Schmidt (Universität Erfurt). Außerdem gibt es praktische Tipps von den Neuen Deutschen Medienmacher*innen und der freien Journalistin Katharina Köll, wie eine differenzierte und faire Berichterstattung gelingen kann – ohne zu verharmlosen.
Die Auseinandersetzung mit und die Prävention von Islamismus ist eine zentrale Herausforderung der aktuellen Zeit. Im Oktober 2024 wurde die Task Force Islamismusprävention auf Initiative der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Leben gerufen. Dies geschah u. a. als Reaktion auf den Anschlag von Solingen im August 2024. Seitdem traf sich die Task Force regelmäßig, um relevante Aspekte der Islamismusprävention zu diskutieren und für das Bundesinnenministerium Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. Das neuköpfige Gremium setzte sich aus Vertreter*innen aus Wissenschaft, Behörden und Zivilgesellschaft zusammen.
Hier gelangen Sie zu den Handlungsempfehlungen zu „sozialen Medien, Radikalisierung und Prävention“.
Neben unserer Geschäftsführerin Jamuna Oehlmann waren auch Lisa Borchardt (Landeskriminalamt Niedersachsen), Claudia Dantschke (Grüner Vogel e. V.), Florian Endres (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF), Dominik Irani (Bayerisches Landeskriminalamt), Julian Junk (PRIF Peace Research Institute Frankfurt), Michael Kiefer (Universität Osnabrück), Mouhanad Khorchide (Universität Münster) und Thomas Mücke (Violence Prevention Network gGmbH) Teil des Gremiums.
Mitte November 2025 wurde die Task Force Islamismusprävention in ihrer bisherigen Form aufgelöst und ein nachfolgendes Gremium einberufen. Aus unserer Sicht ist es zentral, dass etablierte Praktiker*innen der Radikalisierungs- und Präventionsarbeit weiterhin in solchen Gremien vertreten sind. Die Praxisexpertise ist für die wirksame Prävention von Islamismus unverzichtbar. Weiterhin im neuen Gremium vertreten sind Florian Endres (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) sowie Mouhanad Khorchide (Universität Münster).
Wir bedanken uns bei den Mitgliedern der Task Force, beim BMI sowie bei der Koordinierungsstelle für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffen, dass die Expertise aus der praktischen Radikalisierungsprävention auch zukünftig berücksichtigt wird. Für Gespräche und Beratungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wenden Sie sich diesbezüglich gerne direkt an Jamuna Oehlmann.
Medien, Öffentlichkeit und Berichterstattung über islamistische Anschläge
Wie über islamistische Vorfälle oder Anschläge berichtet wird, beeinflusst, wie die Öffentlichkeit Bedrohung, Zugehörigkeit und Verantwortung wahrnimmt. Mediale Darstellungen von Gewalt und Terrorismus prägen langfristig das Sicherheitsgefühl, politische Einstellungen und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Gruppen. Gleichzeitig erfüllen Medien den verfassungsrechtlich garantierten Auftrag, frei,kritisch und unabhängig zu informieren – eine Grundvoraussetzung für demokratische Kontrolle und öffentliche Debatte. Politische Entscheidungsträger*innen können Rahmenbedingungen für Qualitätsjournalismus, Medienkompetenz und wissenschaftliche Evidenz schaffen, um eine offene, widerstandsfähige Gesellschaft zu stärken. Dabei gilt: Islamismus darf weder verharmlost noch alarmistisch überhöht werden – beides schwächt Vertrauen und Resilienz der Gesellschaft
Laden Sie hier das policy:brief No. 4 (PDF) herunter.
Handlungsempfehlungen
- Die mediale und die politische Kommunikation rund um Ereignisse wie Anschläge sollten über ein systematisches Monitoring erfasst und analysiert werden. Die Ergebnisse können in evidenzbasierte Leitlinien für (staatliche) Krisenkommunikation einfließen und im Rahmen von Präventions- und Integrationsstrategien genutzt werden. Um Kontextinformationen schnell und verlässlich verfügbar zu machen, sollten Austauschformate zwischen Behörden, Forschung und Redaktionen gestärkt werden.
- Der Zusammenhang zwischen Medienwirkung, Radikalisierung und Vertrauen sollte fortlaufend Gegenstand interdisziplinärer Forschung sein. Die Ergebnisse sollten etwa in Form von Begleitmaterialien bereitgestellt werden, um sie z. B. in der Ausbildung von Journalist*innen, Fachkräftefortbildungen und in medienpädagogischen Curricula einzusetzen.
- In der Jugendbildung sollten kritische Nachrichtenrezeption, Dialogfähigkeit, Umgang mit Desinformation und Diskurskompetenz gestärkt werden. Als Fokusthemen bieten sich u. a. die Differenzierung im Umgang mit sensiblen Themen sowie für Wirkungen stereotyper Darstellungen an. Dies kann etwa durch die Erweiterung des schulischen Curriculums auf Landesebene oder über Angebote zivilgesellgesellschaftschaftlicher Träger für schulische und außerschulische Bildung geschehen. Zudem bietet sich der Aufbau regionaler Netzwerke zwischen Schulen, Medienhäusern und Präventionsstellen an.
- Unabhängiger Journalismus muss nachhaltig gefördert werden. Eine divers und plural aufgestellte Medienlandschaft ist kein Nachteil, sondern eine demokratische Stärke. Unterschiedliche redaktionelle Zugänge und Deutungen fördern eine nuancierte Berichterstattung und garantieren ein breites Wissensangebot. Gerade im Umgang mit sensiblen Themen oder Anschlägen trägt eine solche Vielfalt dazu bei, Vereinseitigungen und Verzerrungen entgegenzuwirken.
Laden Sie hier das policy:brief No. 4 (PDF) herunter.
Inhaltliche Rückfragen und Presseanfragen: Charlotte Leikert
Die Autor*innen
Charlotte Leikert arbeitet seit 2020 als Referentin, Presse- und Öffentlichkeitarbeit bei der BAG RelEx. Seit 2025 unterstützt sie Jamuna Oehlmann in der Leitung des Projekts KN:IX connect | Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und Psychologie (BA) in Jena und Nizza und absolvierte einen Master mit Schwerpunkt politische Kommunikation an der Freien Universität Berlin. Die Implikationen der Digitalisierung für extremistische Akteure zählen zu ihren Interessensgebieten, mit denen sie sich sowohl während ihres Studiums als auch im Rahmen ihrer Arbeit bei der BAG RelEx auseinandersetzt. Ihre vergleichende Analyse des Framings der Identitären Bewegung und Generation Islam erschien im KN:IX Report 2023. Seit Mitte 2023 ist sie darüber hinaus als freie Moderatorin tätig.
Jamuna Oehlmann ist Geschäftsführerin der BAG RelEx und leitet seit 2025 KN:IX connect | Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Zuvor hatte Sie die Leitung des Kompetenznetzwerks „Islamistischer Extremismus“ (KN:IX, 2020-2024) inne. Sie verfügt über einen akademischen Hintergrund in Asienwissenschaften sowie Internationale Beziehungen und Diplomatie, den sie in Berlin, Bangkok und London erworben hat. In ihren Studien hat sie sich insbesondere mit Fragen der internationalen Sicherheit und des Terrorismus auseinandergesetzt.
Über policy:brief
Das policy:brief der BAG RelEx fasst Positionen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit prägnant zusammen und nimmt dabei besonders Bezug auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen und Herausforderungen. Das policy:brief geht auf der einen Seite einen Schritt zurück und erklärt Zusammenhänge und auf der anderen Seite einen Schritt weiter, indem es zielgruppenorientierte und -gerechte Handlungsempfehlungen enthält. Unsere Arbeit und die unserer rund 40 Mitgliedsorganisationen wird so zielgruppengerecht kommuniziert und der Austausch mit externen Stakeholdern und Akteuren aus Wissenschaft, Politk, Verwaltung und Wirtschaft unterfüttert. Hier kommen Sie zur Übersicht der Ausgaben.

Rechtspopulismus und demokratiefeindliche Diskurse gewinnen europaweit an Einfluss. Debatten über Flucht, Migration und den (vermeintlichen) Zusammenhang mit islamistischer Radikalisierung polarisieren zunehmend. Seit dem 7. Oktober 2023 haben verstärkte islamistische Propaganda und Anschlagsaktivitäten nicht nur die reale Sicherheitslage verschärft, sondern auch die wahrgenommene Bedrohung durch extremistische Kräfte erhöht. Diese Entwicklungen fördern sowohl antisemitische als auch antimuslimische Ressentiments, die selbst in der sogenannten Mitte der Gesellschaft an Akzeptanz gewinnen – ein Klima, das rechtspopulistische Akteur*innen nutzen, um ihre Unterstützerbasis auszubauen. Islamistische Akteur*innen wiederum greifen zunehmende antimuslimische Rhetorik und daraus resultierende Ausgrenzungserfahrungen auf, integrieren sie in ihre Ideologie und instrumentalisieren sie zur Mobilisierung von Anhänger*innen.
Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat heute den Verein „Muslim Interaktiv“ verboten, aktuell laufen Durchsuchungen bei „Realität Islam“ und „Generation Islam“. Die drei Gruppen weisen eine ideologische Nähe zu der in Deutschland verbotenen Hizb ut-Tahrir auf. (mehr …)


